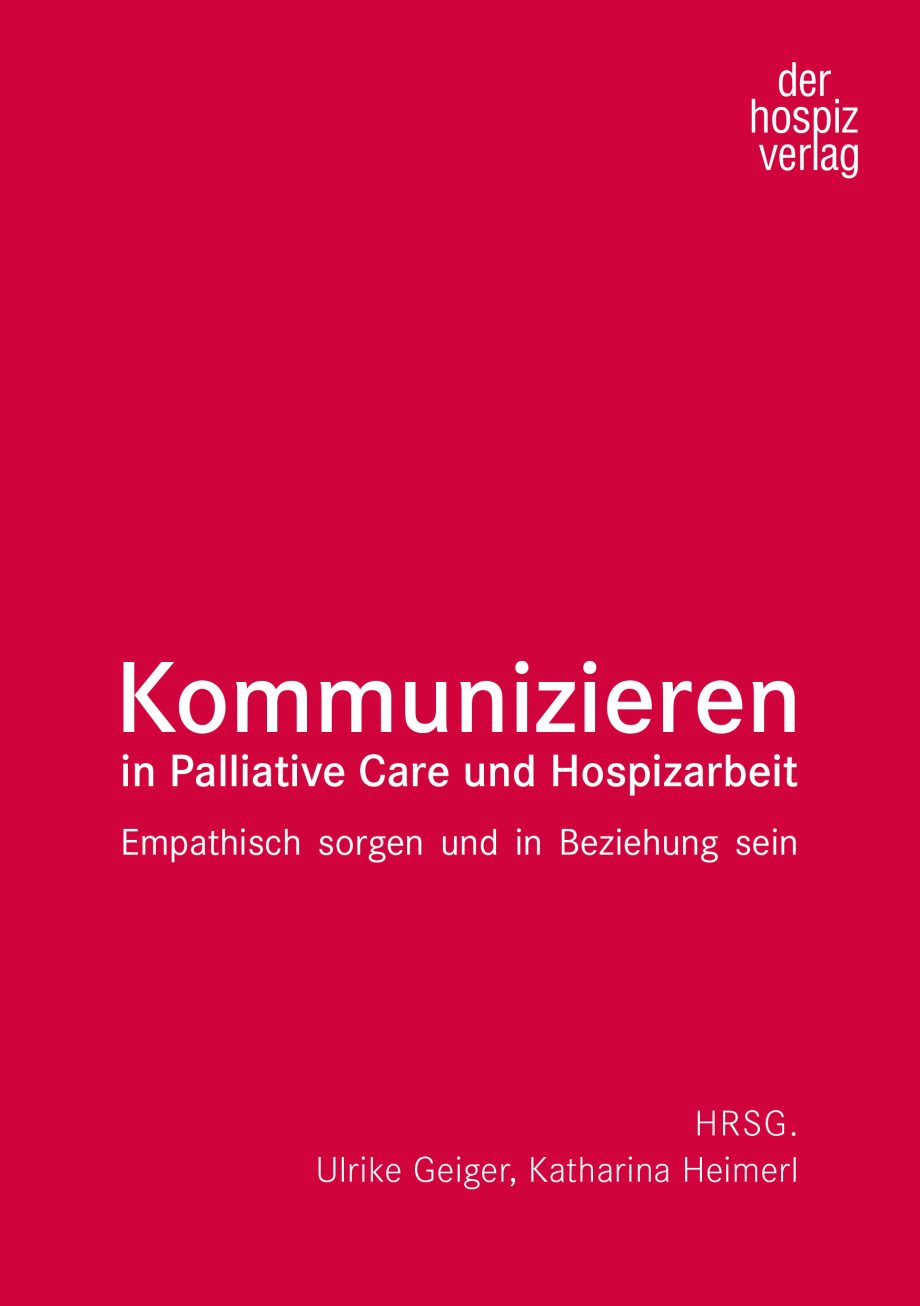Sterbewünsche in der Altenpflege: Wie Pflegekräfte in Österreich damit umgehen
Assistierter Suizid ist in Österreich als eine Möglichkeit, den eigenen Tod mit Hilfe Dritter herbeizuführen, seit Kurzem unter bestimmten Voraussetzungen legal möglich.
Eine kürzlich veröffentliche Studie von M. Werner et al untersuchte vor diesem Hintergrund in zehn problemzentrierten Interviews, wie Pflegekräfte in Institutionen der Langzeitpflege mit dem Sterbewunsch und Fragen nach dem assistierten Suizid umgehen. Die Studie zeigt, dass Pflegende im Umgang mit Sterbewünschen klare berufliche Rollen und Aufgaben erkennen. Beim assistierten Suizid jedoch geraten sie oft in Widersprüche und Unsicherheiten. Drei Themenfelder der Unsicherheiten wurden identifiziert:
(1) der Blick auf die Betroffenen,
(2) Kommunikation als Ressource und Hindernis, und
(3) die Rolle der Pflege selbst.
Der Blick auf die Betroffenen
Sterbewünsche sind oft Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Angst, Einsamkeit oder das Gefühl, eine Belastung zu sein, sind häufige Gründe. Manche ältere Menschen sagen: „Ich will sterben“, meinen aber eigentlich: „Bitte hör mir zu“ oder „Bleib bei mir.“ Aufschlussreiche Einsichten hierzu lieferten bereits Erhebungen in Langzeitpflegeeinrichtungen aus der Schweiz, die zeigten, dass hinter dem Sterbewunsch alter Menschen in den wenigsten Fällen die ernsthafte Absicht steht, das eigene Leben beenden zu wollen
Im Zusammenhang mit assistiertem Suizid gehen die Meinungen der Pflegekräfte laut Studie allerdings auseinander. Einige akzeptieren den Wunsch nach assistiertem Suizid als Ausdruck von Autonomie. Andere sehen darin einen Hilferuf und versuchen, Alternativen aufzuzeigen. Viele berichten von Gefühlen der Ohnmacht, Unsicherheit oder Schuld. Eine Pflegekraft beschreibt es so: „Ich frage mich, was ich versäumt habe, um dem Menschen zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt.“
Kommunikation als Ressource und Hindernis
Der Austausch im Team ist eine große Unterstützung. Gespräche über Sterbewünsche gehören zum Pflegealltag. Doch beim assistierten Suizid gibt es oft Unsicherheiten. Manche finden nicht die richtigen Worte oder verwechseln den Wunsch danach mit anderen Formen der Sterbehilfe.
Eine Pflegekraft berichtet von einer Frau, die ins Heim kam und fragte: „Wann bekomme ich die Spritze?“ Diese direkte Konfrontation mit dem Thema kann belastend sein. Gleichzeitig zeigt sich, dass eine gute Kommunikation oft dazu führt, dass Menschen ihre Meinung ändern. Ein Beispiel: Durch Gespräche und soziale Angebote fand eine ältere Frau neue Lebensfreude – und sprach nicht mehr von ihrem Sterbewunsch.
Die Rolle der Pflege
Pflegekräfte sind oft die ersten Ansprechpartner*innen bei Sterbewünschen. Vor der Legalisierung des assistierten Suizids war ihre Rolle klar: Sie unterstützten Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Nun fragen sich viele: „Ist das jetzt unser Auftrag?“
Einige möchten mit dem Thema nichts zu tun haben, andere sehen es als Teil ihrer Arbeit. Ein zentraler Punkt ist die Frage, wo die Grenze zwischen Begleitung und aktiver Unterstützung liegt. Eine Pflegekraft beschreibt ihre Unsicherheit: „Darf ich für einen Bewohner ein Taxi zum Arzt rufen, wenn er dort die Sterbeverfügung unterschreiben will? Oder ist das dann schon Beihilfe zum Suizid?“
Die Verantwortung der Einrichtung
Die Reaktion der Pflegeeinrichtungen auf das neue Gesetz in Österreich sind unterschiedlich. Manche Organisationen haben klare Anweisungen entwickelt, damit Pflegekräfte nicht in den Prozess des assistierten Suizids eingebunden werden. Andere setzen auf Schulungen, um den Umgang mit Sterbewünschen professionell zu begleiten.
Insgesamt wünschen sich Pflegekräfte mehr Unterstützung durch ihre Arbeitgeber. Eine sagt: „Ich weiß nur, dass wir nicht dabei sein sollen. Aber davor und danach sind wir ja doch da.“ Wenn Einrichtungen eine klare Haltung einnehmen und ihre Mitarbeitenden schulen, fühlen sich Pflegekräfte sicherer. Die Aussagen der Studienteilnehmer zeigen eine gemeinsame Erwartung an das Management, Position zum Thema Sterbewünsche generell und zur Konkretisierung im assistieren Suizid zu beziehen.
Fazit
Sterbewünsche sind ein sensibles Thema. Pflegekräfte stehen vor der Herausforderung, einerseits die Autonomie der Bewohner*innen zu respektieren und andererseits ihre eigene Rolle zu definieren. Während sie sich im Umgang mit allgemeinen Sterbewünschen kompetent fühlen, herrscht beim assistierten Suizid Unsicherheit. Mehr Schulungen, Ethikberatung und Austausch im Team könnten helfen, mit diesen schwierigen Situationen besser umzugehen.
Zum weiterlesen
Eine qualitative Studie zur Perspektive von Pflegenden vor dem Hintergrund des assistierten Suizids
Marlene Werner, Sabine Pleschberger und Katharina Heimerl
Online veröffentlicht: February 21, 2025https://doi.org/10.1024/1012-5302/a001034